- Amsterdam: Zacharias Heyns, 1598. - Bl. 16-98, 2 S. Table; 16 x 20 cm; koloriert
|
|
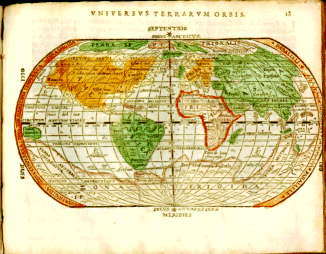 Dieser kleine Weltatlas von 1598 steht in einer langen Reihe kartographischer
und länderkundlicher Werke. Abraham Ortelius (1527-1598 Antwerpen) bereiste nach
humanistischen Studien aus Interesse an der Geographie des alten Römischen Reichs
einen großen Teil Europas, sammelte Münzen und nahm Inschriften auf. In seine
Heimatstadt zurückgekehrt, widmete er sich der Zusammenstellung eines großen
Kartenwerks auf der Grundlage älterer Karten. Mit seinem Theatrum orbis terrarum
von 1570 schuf er den ersten großen Atlas der Epoche des gedruckten Buchs.
Mit unablässigem Fleiß vermehrte er in weiteren Ausgaben, die bis 1595 in dichter
Folge herauskamen, die Zahl der in Kupfer gestochenen Karten von 53 auf mehr als 200.
So erwarb er sich den Ehrentitel eines Ptolemäus seiner Zeit.
Dieser kleine Weltatlas von 1598 steht in einer langen Reihe kartographischer
und länderkundlicher Werke. Abraham Ortelius (1527-1598 Antwerpen) bereiste nach
humanistischen Studien aus Interesse an der Geographie des alten Römischen Reichs
einen großen Teil Europas, sammelte Münzen und nahm Inschriften auf. In seine
Heimatstadt zurückgekehrt, widmete er sich der Zusammenstellung eines großen
Kartenwerks auf der Grundlage älterer Karten. Mit seinem Theatrum orbis terrarum
von 1570 schuf er den ersten großen Atlas der Epoche des gedruckten Buchs.
Mit unablässigem Fleiß vermehrte er in weiteren Ausgaben, die bis 1595 in dichter
Folge herauskamen, die Zahl der in Kupfer gestochenen Karten von 53 auf mehr als 200.
So erwarb er sich den Ehrentitel eines Ptolemäus seiner Zeit.
Schon 1571 besorgte der mit Ortelius befreundete Peeter Heyns (1537-1598), der in Antwerpen zusammen mit seiner Frau eine Schule für Mädchen leitete, eine niederländische Übersetzung der Länderbeschreibungen des Theatrum orbis terrarum. 1577 ließ er einen Auszug des großen Werks folgen, Spieghel der werelt of Epitome orbis terrarum, dessen Text er selbst verfaßte. Die Karten dazu stach im Anschluß an Ortelius der hervorragende Kupferstecher Philip Galle (1537-1612). Auch diese Kurzfassung erlebte zahlreiche Auflagen in verschiedenen Sprachen. Nach dem Tod seines Vaters 1598 brachte Zacharias Heyns (1566 - vor 1638) - nunmehr in Amsterdam, wo die protestantische Familie sich nach Emigrationsjahren in Deutschland niedergelassen hatte - im eigenen Verlag eine vermehrte Ausgabe des erfolgreichen Taschenatlas heraus. Er spiegelt in der Auswahl der Karten - beinahe die Hälfte sind niederländischen Regionen gewidmet - und im begleitenden Text eine Sicht der Welt, die ganz selbstverständlich von dem europäischen, ja, dem niederländischen Standpunkt als dem allein gültigen ausgeht.
Von den Europäern heißt es da, daß sie den übrigen Völkern an scharfer Auffassungsgabe
und körperlicher Geschicklichkeit immer überlegen gewesen und deshalb geeignet seien, die
ganze Welt zu beherrschen. Flandern gilt dem Verfasser als das beste Territorium der
gesamten Christenheit - eine Meinung, die freilich zu seiner Zeit manches für sich hatte.
Die asiatischen Länder östlich des Indus faßt er großzügig zu einer einzigen Region,
Indien genannt, zusammen. Der noch weniger bekannte fünfte Erdteil, Terra australis
incognita, umfaßt neben Australien auch die Antarktis. Dennoch versichert das
Empfehlungsgedicht dem Leser:
"Dies eine Buch ist die ganze Welt. / Die ganze Welt ist nichts als dieses Buch."
Der Besitzer des schön kolorierten kleinen Kartenwerks, H. Zick (oder Zich), vermerkt, daß er es am 25. März 1600 von einem Stiftsherrn der Kathedrale zu Mecheln zum Geschenk erhalten habe. Er fügt zwei Psalmenzitate hinzu, die von Gewissenserforschung und Reue sprechen. So haben Leser früherer Jahrhunderte nicht selten ihren Büchern persönliche Merksprüche anvertraut - ein Indiz dafür, daß der über lange Zeiten fortgesetzte Umgang mit den wenigen Büchern, die man besaß, auch der individuellen Selbstverständigung dienen konnte.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, P, R, S, T, V, W, Z
Heinz Kredel,
E-mail:
kredel@rz.uni-mannheim.de
Mannheim, 31. Oktober 1996